Leben mit Hochbegabung
Anders. Authentisch. Wachsen.
Leben mit Hochbegabung
Anders. Authentisch. Wachsen.
Hochbegabung beschreibt zunächst das Vorliegen einer überdurchschnittlichen kognitiven Leistungsfähigkeit. Im subjektiven Erleben bedeutet dies jedoch viel mehr und beeinflusst das Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Handeln. Viele Jugendliche und junge Erwachsene erleben sich als „anders“, ohne ihre Potenziale oder Schwierigkeiten klar einordnen zu können. Sie denken schneller, stellen tiefere Fragen und empfinden intensiver und stoßen damit häufig auf Unverständnis in ihrem sozialen Umfeld.
Da ich selbst hochbegabt bin, kenne ich die Herausforderungen aus erster Hand. Gerne begleite ich darum auch Sie dabei, sich mit Ihrer Hochbegabung zu beschäftigen und die damit verbundenen ambivalenten Gefühle zu integrieren, alte Wunden loszulassen und mit sich selbst wertschätzend umzugehen, Beziehungsmuster zu klären und neue Wege zu finden, die beruflich und privat wirklich zu Ihnen passen.
Ich arbeite einerseits mit hochbegabten Jugendlichen (ab 14 Jahren) und Erwachsenen. Andererseits begleite ich auch Eltern oder Partnerinnen und Partner sowie Lehrpersonen und andere Fachkräfte, die sich mit mir über das Phänomen Hochbegabung austauschen möchten.
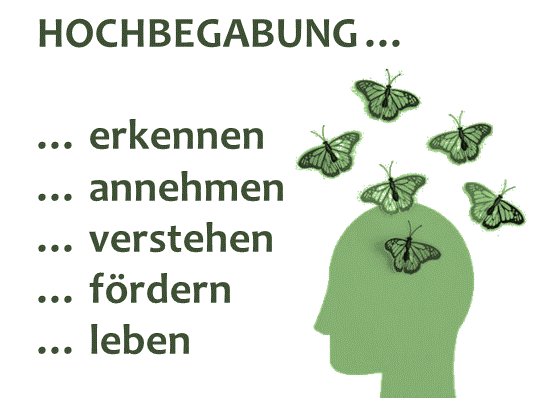
5 Schritte für Ihre Zukunft
Für viele hochbegabgte Menschen ist der Weg in eine Zukunft, die sie sich tief im Inneren wünschen, mit folgenden fünf Schritten verbunden:
- erkennen
Auslöser: "Irgendwas in mir ist anders ... aber was genau?"
Ziel: Typische Merkmale hochbegabten Erlebens bewusst wahrnehmen - annehmen
Auslöser: "Ich mag nicht anders sein. Wie kann ich Frieden schließen mit dem, was mich ausmacht?"
Ziel: Selbstakzeptanz entwickeln und innere Konflikte lösen - verstehen
Auslöser: "Jetzt weiß ich: Ich bin hochbegabt. Wie beeinflusst das mein Leben?"
Ziel: Eigene Funktionsweise, Chancen und Stolpersteine begreifen - fördern
Auslöser: "Wie setze ich meine besonderen Stärken sinnvoll ein?"
Ziel: Freiraum für die Entfaltung schaffen, konstruktive Strategien für Privatleben, Ausbildung und Beruf entwickeln - leben
Auslöser: "Welches Leben passt wirklich zu mir?"
Ziel: Authentizität, Sinn und Selbstbestimmung in den Alltag integrieren
Bei welchem Schritt sind SIE gerade?

|
Identität & Selbstbild |
| |

|
Beziehung & Familie |
| |
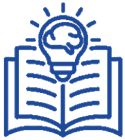
|
Schule & Studium |
| |

|
Beruf & Karriere |
| |

|
Selbstfürsorge & inneres Gleichgewicht |
| |
Als Mitglied sowie geschulter Berater im AlphaGenius Netzwerk ist es mir ein besonderes Anliegen, Hochbegabte zu unterstützen und zu fördern, das Wissen und die Forschung zum Thema voranzubringen und über das Thema Hochbegabung aufzuklären.
Sehr gerne unterstütze ich auch andere Fachkräfte bei der Begleitung von Hochbegabten und deren Familien.
Stichwort: Neurodivergenz
Jeder Mensch ist einzigartig und jedes Gehirn unterscheidet sich von anderen. Das versteht man unter Neurodiversität. Gleichzeitig gibt es gewisse Strukturen und Funktionsweisen, die beim Großteil von Menschen vorkommen. Darauf baut das medizinische Verständnis von "Normalität" auf.
Neurodivergente Gehirne funktionieren in manchen Bereichen jedoch deutlich anders als bei der Mehrheit. Dies kann sich in Phänomenen wie Hochbegabung, Hochsensitivität, ADHS, Autismus, Alexithymie usw. zeigen und individuell unterschiedlich stark in Erscheinung treten.
Je stärker ausgeprägt eine solche "Abweichung" vom Durchschnitt ist, desto eher sind damit besondere Herausforderungen und gleichermaßen Fähigkeiten verbunden, die bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht auftreten. Daher gibt es in der Begleitung von neurodivergenten Personen immer mehrere Perspektiven:
- Verstehen der eigenen "Andersartigkeit"
Wo liegen Stärken, Chancen und Ressourcen? Was sind die Nebenwirkungen, Herausforderungen und Belastungen? - Sich selbst annehmen
"Anders" heißt einfach nur "anders" und nicht "besser" oder "schlechter". Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Mensch zu sein. Und jede davon ist wertvoll und bedeutsam. - Gestalten eines passenden Umfelds
Alles in der Natur gedeiht nur in der richtigen Umwelt. So auch der Mensch: Wie lassen sich Beruf und Freizeit sowie der Umgang mit Freundschaften und Familie auf das eigene Profil abstimmen? - Selbstmanagement
Die eigenen inneren Botschaften hören, konstruktiv damit umgehen und Werkzeuge entwickeln, um situativ auch externe Anforderungen zu bewältigen.
Hinweis: Lebensberatung dient nicht der Diagnose oder Behandlung psychischer Erkrankungen oder Störungen. Bitte holen Sie in solchen Fällen (fach)ärztlichen Rat ein!
Zur begabungsdiagnostischen Abklärung arbeite ich mit einem Netzwerk von sepzialisierten klinischen Psychologinnen zusammen.
Praxisadresse:
Promenadeweg 33
2384 Breitenfurt
Voranmeldung erforderlich!
Telefon: 0676 8796 12970
Mail: beratung@juergen‑noll.at
Sitemap:
Startseite
Über mich
Lebensberatung
Executive Counseling
Hochbegabung
Terminvereinbarung
Kurzbeiträge
Mediathek
Notfallkontakte
Impressum

